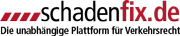Der Fall:
Unsere Mandantin erlitt bei einem Verkehrsunfall einen wirtschaftlichen Totalschaden an Ihrem Kfz.
Sie reparierte ihr Kfz im Vertrauen auf das Gutachten im Rahmen der sog. 130%-Rechtsprechung.
Das Problem:
Die Versicherung bezweifelte – wie die Beweisaufnahme ergab, nicht völlig zu Unrecht – dass alle im Gutachten genannten Schäden tatsächlich alle durch den streitgegenständlichen Unfall entstanden waren. Sie verweigerte daher die Zahlung der Reparaturrechnung und der Gutachterrechnung.
Diesseits wurde u.a. argumentiert, dass der Geschädigte im Vertrauen auf das Gutachten geschützt werden müsse.
Das Urteil:
Das LG Saarbrücken gab der Klage überwiegend statt.
Das OLG Saarbrücken hielt das Urteil weit überwiegend und das obwohl das OLG einen Vertrauensschutz hier verneinte.
Im Einzelnen führt das Gericht wie folgt aus:
„c) Danach hat das Landgericht der Klägerin hier zurecht einen Anspruch auf Ersatz der Reparaturkosten zuerkannt.
aa) Nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Landgerichts hat die Klägerin das Fahrzeug (vollständig) fachgerecht repariert. Die unfallbedingt erforderlichen Reparaturkosten belaufen sich nach den beanstandungsfrei auf Grundlage des Gutachtens des Sachverständigen Dipl.-Ing. Sonnhalter getroffenen Feststellungen des Landgerichts – unter Berücksichtigung einer Wertverbesserung von 150,- € – auf 3.399,13 €. Selbst wenn – wie die Berufunggeltend macht – der Wiederbeschaffungswert des Klägerfahrzeugs lediglich 2.800,- € betragen sollte, übersteigen die Reparaturkosten, bei denen für den Kostenvergleich die Wertverbesserung nicht zu berücksichtigen ist (vgl. OLG Bamberg, Beschluss vom 6. September 2017 – 5 U 74/17, Rn. 4, juris; Freymann/Rüßmann in: Freymann/Wellner, jurisPK-Straßenverkehrsrecht, 2. Aufl., § 249 BGB, Rn. 115), mit (3.399,13 € + 150,- € =) 3.549,13 € den Wiederbeschaffungswert um lediglich 126,75 %. Dass nach der Reparatur ein merkantiler Minderwert verbleiben würde, ist nicht ersichtlich und wird auch von den Beklagten nicht eingewandt. Der Reparaturaufwand übersteigt damit – wie das Landgericht mit Recht angenommen hat – den Wiederbeschaffungswert um weniger als 30 %. Entgegen der Berufung ist unerheblich, dass die für die Reparatur insgesamt angefallenen Kosten mit 4.596,67 € deutlich oberhalb 130 % des Wiederbeschaffungswertes liegen. Denn diese Kosten umfassen die Beseitigung unfallunabhängiger Schäden. Reparaturen, die nur bei Gelegenheit der Instandsetzungsarbeiten mitausgeführt worden sind, haben indes bei der Bemessung des erforderlichen Herstellungsaufwandes grundsätzlich außer Betracht zu bleiben (vgl. BGH, Urteil vom 16. Januar 2024 – VI ZR 266/22, Rn. 15, juris; Urteil vom 29. Oktober 1974 – VI ZR 42/73, BGHZ 63, 182, Rn. 14). Dies gilt auch für die Bemessung des Reparaturaufwands im Rahmen des Kostenvergleichs mit dem Wiederbeschaffungswert.
bb) Erweist sich die Reparatur danach als wirtschaftlich (noch) vernünftig, geht der Hinweis der Beklagten, der Geschädigte könne im Falle einer wirtschaftlich unvernünftigen Reparatur lediglich den
Wiederbeschaffungsaufwand verlangen (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 2. Juni2015 – VI ZR 387/14, Rn. 7, juris; Urteil vom 10. Juli 2007 – VI ZR 258/06, Rn. 6, juris; Urteil vom 8. Februar 2011 – VI ZR 79/10, Rn. 6, juris; Urteil vom 15. Oktober 1991 – VI ZR 67/91, BGHZ 115, 375, Rn. 14), fehl. Anders als die Berufung meint, hat das Landgericht der Klägerin auch keine – nicht geltend gemachten – fiktiven Reparaturkosten zuerkannt, sondern lediglich die konkret angefallenen Reparaturkosten auf die nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme unfallbedingt erforderlichen Kosten herabgesetzt.
cc) Dem Anspruch auf Ersatz der Reparaturkosten steht auch nicht
entgegen, dass das vorgerichtliche Schadengutachten unfallunabhängige Schäden berücksichtigt und sich die für den Kostenvergleich maßgeblichen Werte erst nachträglich durch die Beweiserhebung im gerichtlichen Verfahren ergeben haben. Zwar werden die für den Kostenvergleich maßgeblichen Beträge regelmäßig – und so auch hier – aus einer Prognose resultieren, die der Geschädigte durch Einschaltung seines Sachverständigen erlangt (vgl.Freymann/Rüßmann in: Freymann/Wellner, jurisPK Straßenverkehrsrecht, 2. Aufl., § 249 BGB, Rn. 116). Die Berufung weist auch zutreffend darauf hin, dass die Klägerin – wie auch das Landgericht jedenfalls im Ergebnis mit Recht angenommen hat – auf das von ihr eingeholte Schadengutachten nicht vertrauenkonnte. Denn der Vertrauensschutz des Geschädigten erstreckt sich grundsätzlich nicht darauf, dass die von dem Schadengutachter bei der Schadensermittlung berücksichtigten Schäden unfallbedingt entstanden sind (vgl. BGH, Urteil vom 12. März 2024 – VI ZR 280/22, Rn. 15, juris zum Sachverständigenrisiko; Urteil vom 16. Januar 2024 – VI ZR 266/22, Rn. 15, juris zum Werkstattrisiko). Darauf, ob das Schadengutachten eine taugliche Dispositionsgrundlage bildet, kommt es hier aber nicht an. Denn für die Frage, ob der Geschädigte unter Berücksichtigung der „Integritätsspitze“ die tatsächlich angefallenen (unfallbedingten) Reparaturkosten verlangen kann, ist allein maßgeblich, ob es ihm gelingt, die Reparatur innerhalb der 130%-Grenze fachgerecht und in einem Umfang durchzuführen, wie ihn der Sachverständige zur Grundlage seiner Kostenschätzung gemacht hat, um es nach der Reparaturweiter zu benutzen. Ist dies – wie hier – der Fall, wird der gemäß § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB ersatzfähige Betrag durch den tatsächlich entstandenen Reparaturaufwand und nicht die hiervon abweichende Einschätzung des vorgerichtlichen Sachverständigen abgebildet. Der Geschädigte kann dann Ersatz der tatsächlich angefallenen Reparaturkosten zzgl. eines (etwaigen) merkantilen Minderwerts verlangen (vgl. BGH, Urteil vom 16. November 2021 -VI ZR 100/20, Rn. 10, juris).
2. Ohne Erfolg wendet sich die Berufung auch dagegen, dass das Landgericht der Klägerin dem Grunde nach einen Anspruch auf Erstattung der Kosten des Schadengutachtens zuerkannt hat.
a) Im Ausgangspunkt zutreffend ist das Landgericht davon ausgegangen, dass die Kosten des Schadengutachtens zu den mit dem Schaden unmittelbar verbundenen und gemäß § 249 BGB auszugleichenden Vermögensnachteilengehören, soweit die Begutachtung zur Geltendmachung des
Schadensersatzanspruchs erforderlich und zweckmäßig ist (vgl. BGH, Urteil vom13. Dezember 2022 – VI ZR 324/21, Rn. 8, juris). Wie das Landgericht ferner zutreffend angenommen hat, berührt die Unrichtigkeit und selbst die Unbrauchbarkeit des Gutachtens für sich genommen die Erstattungsfähigkeit derSachverständigenkosten nicht, da der Schadengutachter kein Erfüllungsgehilfe des Geschädigten ist und eine Zurechnung von Fehlern des Sachverständigen nach § 278 BGB daher ausscheidet. Anderes gilt allerdings dann, wenn der Geschädigte die Unbrauchbarkeit des Gutachtens zu vertreten hat, etwa wenn der Geschädigte ihm bekannte Vorschäden verschwiegen und damit – zumindest fahrlässig – die Unbrauchbarkeit des Gutachtens zur Bezifferung des Schadens verschuldet hat (vgl. Senat, Urteil vom 15. März 2024 – 3 U 7/24, Rn. 17, juris mwN).
b) Danach kann die Klägerin hier die Kosten des Schadengutachtens demGrunde nach verlangen. Denn der gerichtliche Sachverständige hat festgestellt, dass der im Schadengutachten vorgegebene Reparaturweg und die kalkuliertenReparaturkosten – losgelöst von den darin enthaltenen nicht zuordenbaren Vorschäden – nicht zu beanstanden sind. Das Schadengutachten ist damit bereits nicht völlig unbrauchbar. Ob – wie das Landgericht angenommen hat – die Klägerin tatsächlich keine konkrete Kenntnis von den unfallunabhängigen Vorschäden hatte, bedarf damit keiner Entscheidung.
3. Die Klägerin kann aber lediglich Sachverständigenkosten in Höhe von 831,69 € verlangen.
a) Den Abschluss einer Preisvereinbarung hat die Klägerin nicht vorgetragen. Ein solcher ist auch sonst nicht ersichtlich. Damit schuldet die Klägerin dem Sachverständigen, da eine Taxe im Sinne des § 632 Abs. 2 BGB für die Erstellung von Schadengutachten der hier fraglichen Art nicht besteht, nur die übliche Vergütung (vgl. BGH, Urteil vom 4. April 2006 – X ZR 122/05, BGHZ 167, 139). Da Schadengutachter im Gerichtsbezirk – senatsbekannt – ihr Grundhonorar orientiert an der Schadenshöhe abrechnen, kann für dieBemessung des üblichen Grundhonorars die Honorarbefragung der BVSK als Schätzgrundlage herangezogen werden, für die Nebenkosten mit Ausnahme der Fahrkosten das JVEG (vgl. Senat, Urteil vom 15. März 2024 – 3 U 7/24, Rn. 31, juris).
b) Nach den Kurzerläuterungen der BVSK-Honorarbefragung 2022 ist für die Schadenshöhe, an der sich das Grundhonorar orientiert, der Wiederbeschaffungswert maßgeblich, wenn – wie hier – die Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert übersteigen. Bei einem Wiederbeschaffungswert zwischen 2.751,- € bis zu 3.000,- € ergibt sich nach der Honorargruppe V ein Mittelwert von 570,50 €. Die abgerechneten Nebenkosten in Höhe von 128,40 € sind insgesamt nicht zu beanstanden. Unter Berücksichtigung der Umsatzsteuer ergeben sich mithin erstattungsfähige SV-Kosten von 831,69 €. Die darüber hinausgehend in Rechnung gestellten Kosten kann die Klägerin auch nicht unter dem Gesichtspunkt des „Sachverständigenrisikos“ verlangen. Denn die Differenz des Grundhonorars ergibt hier sich allein daraus, dass der Wiederbeschaffungswert bei zutreffender Berücksichtigung der Vorschäden niedriger ist als der im Schadengutachten ausgewiesene. Der überhöhte Kostenansatz ist damit nicht unfallbedingt und unterfällt mithin nicht dem Sachverständigenrisiko (vgl. BGH, Urteil vom 12. März 2024 – VI ZR 280/22, Rn.15, juris).“
Offen gesagt, hatte unsere Mandantin Glück, denn wären die Zahlen anders ausgefallen, so hätte Sie – mangels Vertrauensschutz – lediglich Anspruch auf den Wiederbeschaffungsaufwand gehabt.
Man kann Geschädigten nur anraten, den Gutachter gewissenhaft über alle tatsächlichen oder auch nur möglichen Vorschäden zu informieren.
Dass unsere Mandantin hier gutgläubig handelte, weil sie rein tatsächlich nichts bewusst verschweigen wollte, sondern offensichtlich den Zustand des PKW vor dem Unfall nicht mehr in Gänze vor Augen hatte, hätte ihr nicht geholfen, wären die Zahlen letztendlich anders ausgefallen.
Das Aktenzeichen und die vollständigen Urteilsgründe werden wir zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.
Über den Autor:
Rechtsanwalt Klaus Spiegelhalter ist Fachanwalt für Verkehrsrecht in Saarlouis. Rechtsanwalt Spiegelhalter hilft in allen Fragen des Verkehrsrechts insbesondere bei der unbürokratischen Unfallabwicklung (auch per Web-Akte), Bußgeld, Führerscheinproblemen, Punkten in Flensburg usw.
Das Fachanwaltsprofil von Klaus Spiegelhalter
Das Verkehrsrechtsportal finden Sie hier: